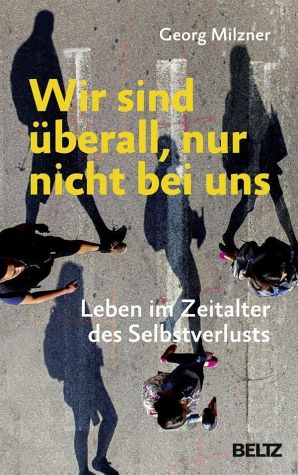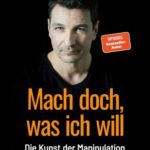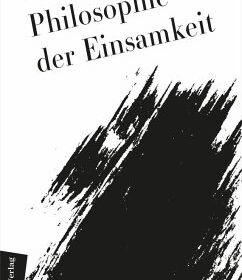Selbsterfahrung ist generell erstrebenswert
Von einem Therapeuten erwartet man, dass er über Selbsterfahrung verfügt. Denn man geht davon aus, dass jemand, der eine solche Tätigkeit ausübt, sich selbst kennen sollte. Man könnte nun die Frage stellen, ob Selbsterfahrung nicht generell erstrebenswert ist. Nicht im organisierten, klinischen Ausbildungssinn. Aber doch so, dass erfülltes Leben etwas damit zu tun hat, die Zonen der eigenen Person immer weiter auszuloten. Georg Milzner erklärt: „Denn Selbsterfahrung zu sammeln ist etwas anderes, als bloß Erfahrungen zu machen. Selbsterfahrung meint jene Kategorie von Erlebnissen, in denen ich etwas über mich erfahre, weil ich mein Verhalten und meine Erlebnisweisen auslote.“ Sogar manches Ehrenamt, dem vielleicht ein Hauch von Gutmenschentum anhaftet, bekäme neuen Glanz, wenn man es als Selbsterfahrung beschreiben würde. Georg Milzner ist Diplompsychologe und arbeitet in eigener Praxis als Psychotherapeut.
Das Selbst ist niemals stromlinienförmig
Auch hinsichtlich der Arbeitswelt könnte die aufgewertete Rolle der Selbsterfahrung noch einmal zu ganz besonderen Entwicklungen führen. Georg Milzner stellt sich vor, dass es die Entscheidungsnöte heute Heranwachsender um einiges vermindern könnte, wenn sie sich von der Aufgabe befreit sähen, mit dieser Entscheidung alle Weichen auf einmal zu stellen. Wenn das Angebot dagegen wäre, für sich sorgen zu lernen und das eigene Selbst zu erkunden, hätten sie die Möglichkeit, erst einmal bei sich anzusetzen.
Bis heute ist der Zwang zur stromlinienförmigen Biografie eine der Absurditäten, mit denen die Arbeitswelt aufwartet. Selbsterfahrung als Ressource bedarf einer neuen Einschätzung äußeren Tuns. Georg Milzner rät: „Seien Sei möglichst weiträumig unterwegs. Das Selbst ist niemals stromlinienförmig, denn Selbst bedeutet Vielfalt.“ Das Selbst und die Technik ist dagegen ein altes Problem. Und in der Moderne immer wieder eines, in dem die Technik als der Feind des Menschlichen erscheint.
Zeiten der Gefährdung ermöglichen Neudefinitionen
Philosophen wie Martin Heidegger und Dichter wie Friedrich Georg Jünger waren überzeugt davon, dass die Technik den Menschen von sich selbst entfremden und eine kalte, sinnentleerte Welt hervorbringen werde. Sichtweise wie diese werfen Fragen auf. Und eigentlich schiene Entfremdung durch Technik auch ein paradoxes Phänomen. Etwas, was menschliche Wissenschaft hervorbringt, soll den Menschen in seinem Selbst-Sein gefährden? Nun sind Zeiten der Gefährdung immer auch Zeiten möglicher Neudefinitionen.
Wenn es also an der Zeit ist, das Selbst neu zu entdecken, warum dann nicht unter Einbeziehung dessen, was die Menschen als neue Medienlandschaft umgibt? Das Selbst, wie man es kannte, konstituiert sich neu: in einem Umfeld neuer Technologien. Konservative Gemüter möchten dies alles negieren und am liebsten dorthin zurück, wo die Technik noch nicht so einflussreich war. Wann aber sollte dies gewesen sein? Der Mensch ist ja – viel mehr als jedes Tier – auch ein technisches Wesen. Eines, das Dinge entwirft und erfindet, die dann zurückwirken auf den Menschen selbst. Quelle: „Wir sind überall, nur nicht bei uns“ von Georg Milzner
Von Hans Klumbies