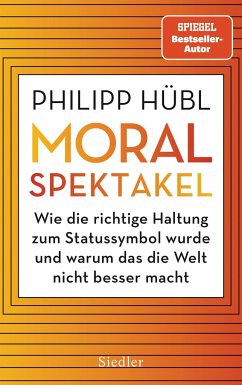Manchmal kommt es zu Begriffserweiterungen
Die Rede von Mikroaggressionen ist inzwischen in die Alltagssprache vorgedrungen, die Forschungsdaten dazu sind allerdings sehr fragwürdig. Philipp Hübl weiß: „Ein Zusammenhang zwischen unbedachten Äußerungen und negativen Folgen für die mentale Gesundheit konnte bisher nicht empirisch belegt werden, auch nicht, dass vermeintliche Mikroaggressionen irgendetwas mit Vorurteilen oder feindseligen Motiven zu tun haben.“ Wieso kommen Wissenschaftler dennoch auf die Idee, Komplimente als Aggressionen anzusehen, sogar dann, wenn niemand einen Schaden davonträgt? Ein Grund ist, dass in der Wissenschaft und der Gesellschaft neuen Entdeckungen mit Anerkennung belohnt werden, insbesondere wenn es um moralisches Fehlverhalten geht. Mit einem Begriff wie „Stalking“ beispielsweise kann man ein gefährliches Verhaltensmuster besser erkennen und sogar zu einem Straftatbestand erklären. Philipp Hübl ist Philosoph und Autor des Bestsellers „Folge dem weißen Kaninchen … in die Welt der Philosophie“ (2012).
Mikroaggressionen sind ein rein sprachliches Phänomen
Einerseits kalibrieren neue Begriffe unsere Aufmerksamkeit, sodass uns plötzlich Dinge auffallen, die uns bisher entgangen waren. Philipp Hübl stellt fest: „Andererseits tritt auch der umgekehrte Fall ein: Wenn wir stärker auf etwas achten, zum Beispiel auf Gefahren oder Aggressionen, dehnen wir dadurch unsere Begriffe aus.“ Und so können sogar Forscher zu dem Fehlschluss gelangen, sie seien einer großen Sache auf der Spur, zum Beispiel bisher unentdeckten „Mikroaggressionen“, ohne zu bemerken, dass sie keinem realen, sondern einem rein sprachlichen Phänomen hinterherjagen.
Eine Reihe von faszinierenden Experimenten macht das deutlich. In einer Variante sehen Versuchspersonen unterschiedliche Gesichter auf einem Bildschirm, die sie auf einer Skala „sehr bedrohlich“ und „gar nicht bedrohlich“ einordnen sollen. Bei jedem Durchlauf gegen sie dieselben Einschätzungen. Philipp Hübl ergänzt: „Doch sobald die Probanden immer weniger bedrohliche Gesichter zu sehen bekommen, passiert etwas Merkwürdiges. Plötzlich ordnen sie auch bisher harmlose Gesichter als „bedrohlich“ ein.“
Die Begriffserweiterung tritt in allen Bereichen der Kognition auf
Im Englischen heißt dieses Phänomen „concept creep“, also sinngemäß „Begriffserweiterung“. Die Probanden erweitern ihren Begriff, also ihre mentale Kategorie von „bedrohlich“, sodass sie jetzt mehr Fälle umfasst. Philipp Hübl fügt hinzu: „Derselbe Effekt trat auf, als Probanden Forschungsanträge beurteilen sollten, von denen einige ethisch vertretbar, andere hingegen ethisch problematisch waren.“ Auch hier wurden die Testpersonen immer strenger, je weniger problematische Anträge sie pro Durchgang zu lesen bekamen.
Unbewusst hatten sie den Anwendungsbereich von „ethisch problematisch“ erweitert. Ganz automatisch und ohne es zu merken, erweitern Menschen ihre mentalen Kategorien, sobald sie auf etwas achten, das ihnen seltener begegnet. Philipp Hübl erläutert: „Da Begriffserweiterung in allen Bereichen der Kognition auftritt, sogar bei der Farbwahrnehmung, handelt es sich offenbar um eine fundamentale Eigenschaft des menschlichen Geistes.“ Quelle: „Moralspektakel“ von Philipp Hübl
Von Hans Klumbies